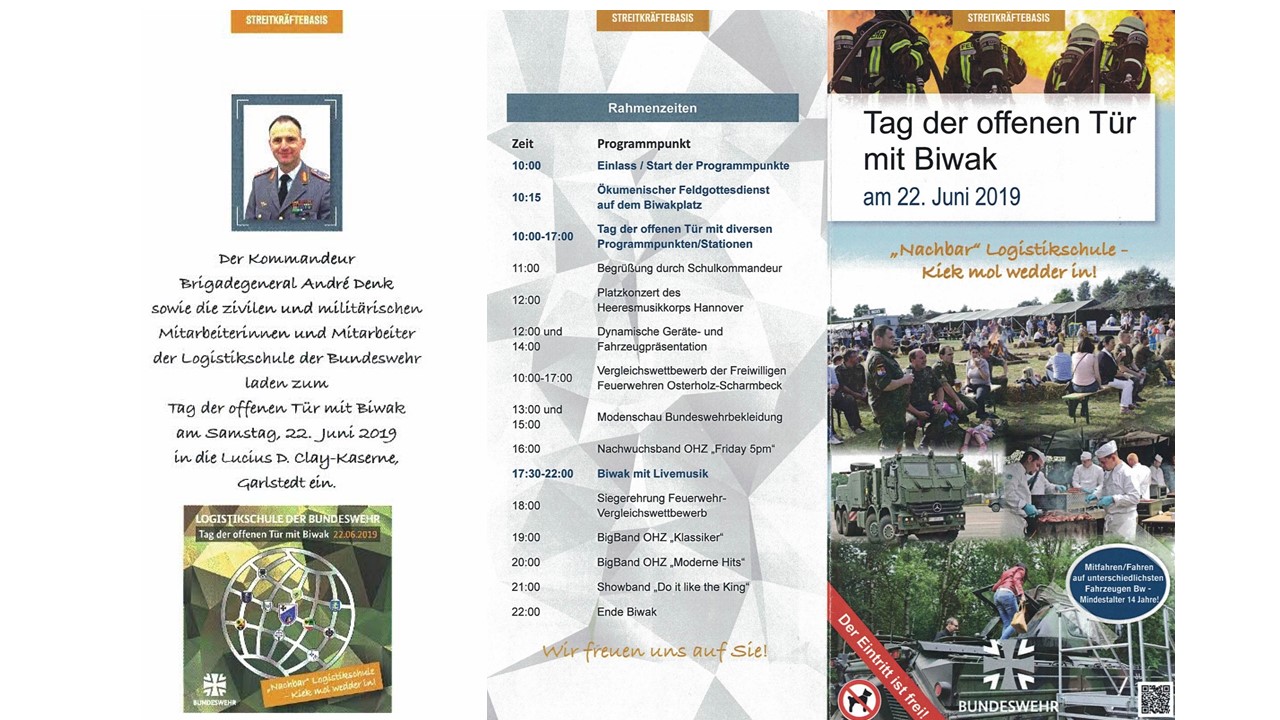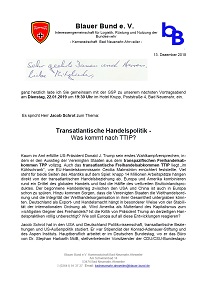Sie ist derzeit in aller Munde. Für Gegner ist sie ein Zwangsdienst oder die Wehrpflicht durch die Hintertür. Befürworter sprechen von der Dienstpflicht oder dem allgemeinen Gesellschaftsdienst. Seit 2015 sein führender Verfechter: der Reservistenverband.
Aus dem politischen Winterschlaf geholt hat das Thema CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Um sich ein Bild davon zu machen, was die Parteibasis bewegt, hat sie auf ihrer „Zuhörtour“ in diesem Sommer an 40 Stationen zahlreiche Mitglieder getroffen. Und dort sind Wehr- oder Dienstpflicht tatsächlich Thema. Mit einem Videobeitrag auf der Webseite ihrer Partei brachte sie das Thema vor einigen Wochen schließlich auf das Tableau der Bundespolitik. Verstärkt durch die Personalnot der Bundeswehr, den vielfältigen Stellenbedarf gemeinnütziger und sozialer Einrichtungen und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, bestimmt es seitdem den politischen Sommerdiskurs. Die Bild am Sonntag vom 12. August beschäftigt sich mit dem Thema auf vier Seiten. Die Nummer 33 des Magazins „Woche“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat es als Aufmacher. Alle Tageszeitungen berichten.
Im Gegensatz zur CDU-Parteibasis lehnt die Regierung einen verpflichtenden Gesellschaftsdienst ab, wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer Anfang August mitteilte. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begrüßt zwar die Diskussion an sich, bezieht in der Sache jedoch keine klare Position. Viele Journalistinnen und Journalisten haben die Debatte um die Sinnhaftigkeit einer Dienstpflicht zunächst als Sommerloch-Thema abgetan. Es ist ein großes Sommerloch, denn mittlerweile haben sich zahlreiche Bürger, Journalisten, Interessenverbände und viele der Parlamentarier darin vertieft. Und laut Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen sprechen sich immerhin 68 Prozent von 1294 Befragten für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht aus.
Gesellschaftsdienst statt Wehrpflicht.
„Die Wiedereinführung der (alten) Wehrpflicht ist weder hilfreich noch sinnvoll“, sagt der Präsident des Reservistenverbandes und Oberst d.R. Oswin Veith MdB. Vielmehr sei es an der Zeit, über die Einführung eines allgemeinen Gesellschaftsdienstes nachzudenken. Der Unterschied: Die Wehrpflicht bestand nur für Männer. Wer verweigerte, musste den Zivildienst ersatzweise leisten. Das galt zumindest so lange, wie die Wehrgerechtigkeit noch gegeben war und konsequent alle Männer eines Jahrganges gemustert wurden. Beim allgemeinen Gesellschaftsdienst geht es nicht mehr darum, junge Männer an der Waffe auszubilden. Stattdessen sollen nun alle jungen Menschen nach ihrem Schulabschluss einen Dienst an der Allgemeinheit leisten – auch dies verpflichtend, wohlgemerkt.
„Wir stellen uns vor, dass sich junge Männer und Frauen ab 18 Jahren ein Jahr lang verpflichten, sich zu engagieren. Unterhalb dieser Pflicht wollen wir die Möglichkeit einer breiten Wahl lassen; beispielsweise Dienst in den Streitkräften, der Reserve, in den Blaulichtorganisationen und Hilfsdiensten, der Pflege, im Gesundheitsbereich ebenso wie in sozialen und karitativen Verbänden etc. Da ist vieles denkbar und möglich. In Teilen könnte dieser Pflichtdienst sogar unabhängig von der Staatsbürgerschaft angeboten werden“, beschreibt Veith. Dass ein „Zwangsdienst“ eben nicht „nichts bringt“ – wie zum Beispiel Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, in einem Interview mit der Wirtschaftswoche vom 6. August argumentiert – zeigt die jüngste deutsche Vergangenheit – der Zivildienst bis 2011 hat funktioniert.
Zwang oder Freiheit?
„Zwang“ ist ein starker Begriff der mit zahlreichen negativen Assoziationen verknüpft ist. Nicht umsonst wird er gern von den Gegnern des Gesellschaftsdienstes verwendet. Zu Recht? Ein Beispiel: Programme wie das Freiwillige Soziale Jahr seien ein Zuschussgeschäft für die Teilnehmenden und würden deshalb vornehmlich von Sprösslingen gut situierter Akademikerfamilien in Anspruch genommen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung am 12. August. Junge Menschen haben also durchaus ein Interesse am Dienst an der Gesellschaft. Menschen aus einkommensschwachen Familien dieses Interesse pauschal abzusprechen, wäre diskriminierend. Für sie könnte der Gesellschaftsdienst bei gerechter Entlohnung also eine Befreiung bedeuten. Nämlich eine Befreiung von ökonomischen Zwängen, die verhindern, dass sie sich auf gleichberechtigte Art und Weise ausprobieren dürfen, Neigungen nachgehen und Fähigkeiten entwickeln.
Für Josa Mania-Schlegel bedeutet ein Gesellschaftsdienst genau das: Freiheit. Der Journalist hat Zivildienst geleistet und hält in einem Kommentar vom 10. August im Online-Magazin Krautreporter ein entsprechendes Plädoyer. Für ihn ist der Gesellschaftsdienst eine einzigartige Möglichkeit, den Pflichten des Lebens – Schule, Ausbildung, Universität oder Beruf – für eine gewisse Zeit eine Absage zu erteilen. Auch Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, setzt sich in einem Videokommentar vom 7. August mit Nachdruck für einen Gesellschaftsdienst ein. Er wirbt für ein „soziales Erfahrungsjahr“, ein „Jahr der Begegnung“ und „ein Jahr der Erkenntnis für die Nöte der Gesellschaft.“
Aus dem „Ich“ ein „Wir“ werden lassen Die breite Debatte dreht sich um junge Menschen als „Zielgruppe“ für den Gesellschaftsdienst. Es geht darum, ihnen in unserer Ich-bezogenen Gesellschaft ein Gefühl von Gemeinschaft und die Bedeutung wechselseitiger Verantwortung zu vermitteln. Der Gesellschaftsdienst bietet die Möglichkeit, Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten zusammenzuführen, ihnen Vorurteile und vielleicht auch Ängste zu nehmen. „Die Einbindung aller jungen Menschen in einen solchen Dienst an der Gesellschaft könnte Zusammenhalt und Widerstandsfähigkeit stärken und die Identifikation mit dem eigenen Land wieder fördern“, sagt Veith dazu. Und das ist unbezahlbar.
Trotzdem unternimmt die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem Artikel vom 14. August den Versuch, mögliche Kosten der Einführung des Gesellschaftsdienstes zu schätzen. 13 Milliarden Euro sollen dadurch jährlich anfallen, wenn man einen Mindestlohn von 9,35 Euro (ab 2020 gültig), eine Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden und 700.000 Dienende pro Jahrgang zu Grunde legt. Wer sich aber auf dieses Argument stützt, macht es sich bequem. Denn die immateriellen Werte auf Seiten des Gesellschaftsdienstes lassen sich nicht mit einer Geldsumme ausdrücken.
Heute für die Zukunft Deutschlands eintreten
Das Strohfeuer hat sich mittlerweile zu einem Waldbrand entwickelt – um im thematischen Sommer-Kontext zu bleiben. Geht es nach Kramp-Karrenbauer, wird die Frage nach dem Gesellschaftsdienst Thema auf dem CDU-Parteitag Ende des Jahres. Auf diesem werden auch Leitfragen für die Erstellung eines neuen Grundsatzprogrammes diskutiert. „Gesetzlich sind zahlreiche Hürden zu nehmen, vieles wird neu gedacht und überarbeitet werden müssen. Das braucht seine Zeit und muss breit diskutiert werden. Daher müssen wir die Debatte darüber heute führen, um auch in Zukunft in einer sicheren, wehrhaften Gesellschaft leben, die Sicherungssysteme aufrechterhalten und die Herausforderungen für unser Land angemessen bewältigen zu können“, sagt Veith. Die Hürden bleiben damit hoch, aber ein Anfang ist gemacht.
Quelle:
Reservistenverband, Postfach 20 14 64, 53144 Bonn
Ein Beitrag aus Loyal – Das Magazin für Sicherheitspolitik, September-Ausgabe „Das Zerwürfnis“
Autor: Julian Hückelheim